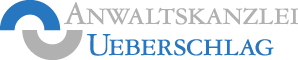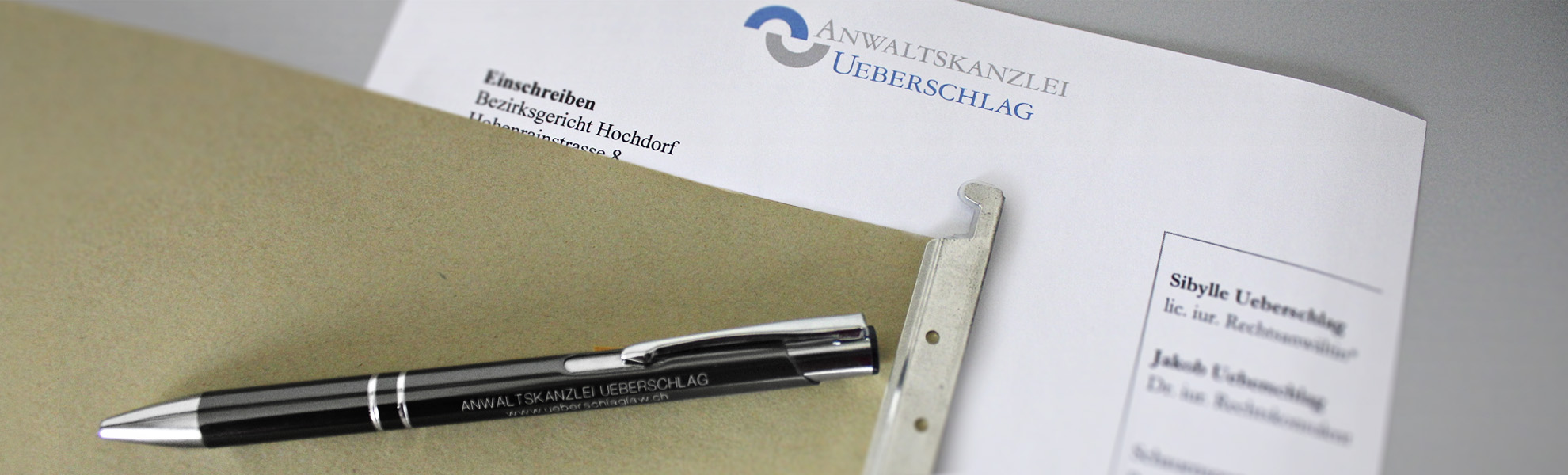Häufig gestellte Fragen
Familien-, Ehe-, Konkubinats- und Scheidungsrecht
1. Wie muss man vorgehen, wenn man sich scheiden lassen möchte?
3. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn sich der Ehepartner nicht scheiden lassen möchte?
9. Wer darf in der ehelichen Wohnung/im Haus bleiben?
10. Was wird mit der Scheidung auch noch geregelt?
Arbeitsrecht
1. Wie gelangt man vom Monatslohn zum Tages- bzw. Stundenlohn?
3. Welche Ferienkürzungen sieht das Obligationenrecht vor?
4.Wie ist die Ferienkürzung zu berechnen?
5. Unter welchen Voraussetzungen muss der AN Überstundenarbeit leisten?
6. Wann und wie ist Überstundenarbeit abzugelten?
7. Kann einem erkrankten AN gekündigt werden?
8. Welcher gesetzliche Kündigungstermin ist vorgesehen?
9. Ist der gesetzliche Kündigungstermin vertraglich abänderbar?
Altersfragen
1. Was ist ein Vorsorgeauftrag?
2. Wie ist ein Vorsorgeauftrag zu verfassen?
3. Was sollte hinsichtlich des Inhalts eines Vorsorgeauftrags beachtet werden?
4. Wer hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen?
5. Wie hoch sind die Ergänzungsleistungen?
6. Wie werden Einkünfte und Vermögenswerte behandelt, auf welche verzichtet wurde?
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
1. Wie wird die Betreibung eingeleitet?
2. Wie viel kostet eine Betreibung?
3. Wer trägt die Kosten einer Betreibung?
4. Wie geht es weiter, wenn die Betreibung eingeleitet wurde?
5. Was ist ein Rechtsvorschlag und was bewirkt er?
6. Wie kann der Rechtsvorschlag beseitigt werden?
8. Was passiert, wenn der Schuldner kein pfändbares Vermögen hat?
9. Wann verjährt die vom Verlustschein betroffene Forderung?
Familien-, Ehe-, Konkubinats- und Scheidungsrecht
1. Wie muss man vorgehen, wenn man sich scheiden lassen möchte?
Grundsätzlich gibt es zwei Varianten, wie man sich scheiden lassen kann:
- Sofern beide Ehegatten mit der Scheidung einverstanden sind, kann man beim Gericht ein gemeinsames Scheidungsbegehren und – sofern man sich auch bezüglich der Scheidungsfolgen (wie Unterhalt, eheliche Wohnung, Güterrecht) einig ist – eine (Teil-)Vereinbarung über die Scheidungsfolgen einreichen (Art. 111 / 112 ZGB). Nach einer richterlichen Anhörung wird die Ehe – falls alle Voraussetzungen erfüllt sind – vom Gericht geschieden und die Scheidungsfolgen, über die man sich nicht einigen konnte, werden geregelt.
- Möchte sich nur ein Ehegatte scheiden lassen, kann er nach einer mind. zweijährigen Trennungszeit eine Scheidungsklage beim Gericht einreichen (Art. 114 ZGB). Die Ehe wird dann vom Gericht geschieden und die Scheidungsfolgen werden geregelt.
Getrenntleben (Art. 175 ff. ZGB) bedeutet, dass man den gemeinsamen Haushalt aufhebt, wobei die Wirkungen der Ehe fortdauern. Die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts muss nicht vom Gericht angeordnet werden, jedoch werden regelmässig – wenn sich die Ehegatten nicht einig sind – die Folgen des Getrenntlebens (wie Obhut und persönlicher Verkehr der unmündigen Kinder, Zuweisung der Wohnung, Kinderunterhalt, Ehegattenunterhalt) vom Gericht geregelt. Der trennungswillige Ehegatte hat drei Möglichkeiten:
- Aussergerichtliche Vereinbarung: Sind sich beide Ehegatten bezüglich des Trennungswillens und der Trennungsfolgen einig, so müssen sie nicht das Gericht anrufen. Sind jedoch gemeinsame minderjährige Kinder vorhanden oder wurden Ehegattenunterhaltsbeiträge vereinbart, so müssen die diesbezüglichen Regelungen vom Gericht genehmigt werden.
- Eheschutzgesuch: Besteht der Trennungswille nur bei einem der Ehegatten bzw. können sich die Ehegatten nicht über die Trennungsfolgen einigen, so kann jeder Ehegatte beim Gericht ein sog. Eheschutzgesuch (auch Trennungsbegehren) einreichen. Nach einer gerichtlichen Anhörung wird der gemeinsame Haushalt aufgehoben und die Trennungsfolgen werden geregelt.
- Trennungsvereinbarung: Sind sich die Ehegatten bezüglich der Trennung und deren Folgen einig, so können sie gemeinsam eine Trennungsvereinbarung beim Gericht einreichen. So regeln sie die Folgen der Trennung unter sich und diese Regelung kann vom Gericht bestätigt werden.
Vorlagen für das gemeinsame Scheidungsbegehren, die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, Scheidungsklage, Trennungsbegehren sowie Trennungsvereinbarung: https://gerichte.lu.ch/rechtsgebiete/formulare.
2. Ist es möglich, sich – ohne Einverständnis des Ehegattens – schon vor der zweijährigen Trennungszeit scheiden zu lassen?
Vor Ablauf der zweijährigen Trennungszeit kann ein Ehegatte nur ausnahmsweise die Scheidung verlangen, und zwar wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet werden kann (Art. 115 ZGB). Das Gericht geht bei der Auslegung der «schwerwiegenden Gründen» sehr restriktiv vor (z.B. bei schwerer körperlicher und seelischer Misshandlung oder bei einseitiger Scheinehe).
Für die Regelung der Verhältnisse während der Trennung, kann beim Gericht ein Trennungsgesuch oder – falls man sich über die Folgen der Trennung einig ist – eine Trennungsvereinbarung eingereicht werden (vgl. Ausführungen zu Frage 1).
3. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn sich der Ehepartner nicht scheiden lassen möchte?
Falls die Fortführung der Ehe nicht im Sinne von Art. 115 ZGB unzumutbar ist (vgl. Ausführungen zu Frage 2), bleibt nur die Möglichkeit, die zweijährige Trennungsfrist abzuwarten und danach eine Scheidungsklage einzureichen. Für die Regelung der Verhältnisse während der Trennung, kann beim Gericht ein Trennungsgesuch oder – falls man sich über die Folgen der Trennung einig ist – eine Trennungsvereinbarung eingereicht werden (vgl. Ausführungen zu Frage 1).
4. Bei welchem Gericht muss das Scheidungsbegehren inkl. (Teil-)Vereinbarung bzw. die Scheidungsklage eingereicht werden?
Das Scheidungsbegehren inkl. (Teil-)Vereinbarung bzw. die Scheidungsklage ist für Ehegatten, die in der Schweiz leben, beim Zivilgericht am Wohnsitz einer der beiden Ehegatten einzureichen (Art. 23 Abs. 1 ZPO).
Falls ein Ehegatte Wohnsitz im Ausland hat, kommt das internationale Privatrecht unter Berücksichtigung internationaler Staatsverträge zur Anwendung.
5. Wie wird die «elterliche Sorge», «Obhut» sowie der «persönlicher Verkehr» bzw. der «Betreuungsanteil» der gemeinsamen unmündigen Kindern im Scheidungsverfahren geregelt?
Die Regelung kann wie folgt aussehen (vgl. Art. 133 ZGB):
- Elterliche Sorge: In der Regel behalten die Eltern auch nach der Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge (Art. 298 Abs. 2 ZGB). Dies bedeutet, dass die Eltern gemeinsam über den Aufenthaltsort und die Erziehung der Kinder sowie über die Verwaltung des Kindervermögens entscheiden und dass sie beide die gesetzliche Vertretung der Kinder ausüben. Das Gericht kann jedoch ausnahmsweise einem Ehegatten die alleinige elterliche Sorge übertragen, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls notwendig ist (z.B. bei Abwesenheit oder Gewalttätigkeit eines Elternteils; vgl. Art. 298 Abs. 1 ZGB).
- Obhut (Art. 298 Abs. 2 ZGB): Die Obhut umfasst das Recht bzw. die Befugnis, mit dem Kind zusammenzuleben und für seine tägliche Betreuung und Erziehung zu sorgen. Bei alleiniger elterlicher Sorge hat der sorgeberechtigte Elternteil automatisch auch die Obhut. Bei gemeinsamer elterlicher Sorge kann das Gericht entweder einem Ehegatten die alleinige Obhut zuteilen oder eine sog. alternierende Obhut beider Ehegatten (z.B. von Montag bis Donnerstag beim einen und von Freitag bis Sonntag beim anderen Elternteil) anordnen. An oberster Stelle stehen dabei jedoch nicht die Wünsche der Eltern, sondern das Kindeswohl. Entscheidend sind die Beziehung der Kinder zu den beiden Elternteilen, die Erziehungsfähigkeiten der Eltern und die Bereitschaft der Eltern, sich persönlich um die Kinder zu kümmern. Die Regelung der Obhut soll zu stabilen Beziehungen und damit zu einer optimalen Entwicklung der Kinder führen.
- Persönlicher Verkehr (Art. 298 Abs. 2 ZGB): Bei alleiniger elterlicher Sorge oder bei gemeinsamer elterlicher Sorge, aber alleiniger Obhut eines Ehegatten, haben der nicht sorge-/obhutsberechtigte Ehegatte sowie die Kinder ein gegenseitiges Besuchs- und Ferienrecht. So kann festgelegt werden, wie oft (und wann) der nicht sorge-/obhutsberechtigte Ehegatte die Kinder besuchen oder sie zu sich auf Besuch / in die Ferien nehmen darf. Dabei gilt die Regelung nach Art. 273 ff. ZGB.
- Betreuungsanteile (Art. 298 Abs. 2 ZGB): Bei gemeinsamer elterlicher Sorge und alternierender Obhut spricht man vom Betreuungsanteil, der geregelt werden muss. Dabei gilt die Regelung des persönlichen Verkehrs nach Art. 273 ff. ZGB analog.
6. Muss ich Unterhalt für meine unmündigen Kinder bezahlen bzw. erhalte ich Unterhalt für meine unmündigen Kinder?
Eltern sind auch nach der Scheidung weiterhin verpflichtet, für den Unterhalt ihrer Kinder aufzukommen; zumindest bis zu ihrer Volljährigkeit bzw. bis zur abgeschlossenen Erstausbildung (Art. 276 ff. ZGB). Der nicht sorge-/obhutsberechtigte Ehegatte schuldet dem unmündigen Kind in der Regel Unterhalt in Form einer Geldzahlung an den sorge-/obhutsberechtigten Ehegatten, jedoch nur soweit beim zahlungspflichtigen Ehegatten nicht ins betreibungsrechtliche Existenzminimum eingegriffen wird (d.h. nur, wenn der zahlungspflichtige Ehegatte sein Leben trotz der Unterhaltsbeiträge selbst noch finanzieren kann). Man unterscheidet zwischen Barbedarf und Betreuungsunterhalt:
- Barbedarf: Dabei handelt es sich um Bedarfspositionen jedes Kindes wie z.B. Grundbetrag (für Nahrung und Kleider), Wohnkostenanteil, Krankenkassenprämien, Schulkosten, Fremdbetreuungskosten. Ist der unterhaltspflichtige Elternteil zur Finanzierung des Barunterhalts der Kinder nicht in der Lage, so wird für jedes Kind das sog. Manko festgesetzt. Verbessern sich die finanziellen Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich (z.B. durch Lottogewinn oder Erbschaft), können die nicht gedeckten Unterhaltsbeiträge der letzten fünf Jahre im Nachhinein eingefordert werden.
- Betreuungsunterhalt: Der Betreuungsunterhalt soll die Betreuung des Kindes durch Eltern oder Dritte gewährleisten. Er umfasst die Lebenshaltungskosten (wie Grundbetrag, Wohnkosten, Hausrat-/Haftpflichtversicherung, Krankenkassenprämien, berufsbedingte Kosten etc.) des betreuenden Elternteils. Da der betreuende Elternteil aufgrund der Kinderbetreuung keiner oder nur einer begrenzten Erwerbstätigkeit nachgehen kann, muss der unterhaltspflichtige Ehegatte auch für die Kosten des betreuenden Elternteils aufkommen, soweit diese nicht gedeckt sind.
7. Muss ich Unterhalt für meinen Ehegatten/meine Ehegattin bezahlen bzw. habe ich Anspruch auf einen solchen?
Ist es einem Ehegatten nicht zuzumuten, für seinen Unterhalt selbst aufzukommen (d.h. kann kein oder zu wenig Einkommen erzielen), so muss der andere Ehegatte einen angemessenen Beitrag (sog. nachehelicher Unterhalt) leisten. Dabei werden die Gesamtumstände wie Aufgabenteilung und Lebensstellung während der Ehe, Dauer der Ehe, Alter/Gesundheit der Ehegatten und Einkommen/Vermögen als Massstab genommen (Art. 125 ZGB). Nachehelicher Unterhalt ist jedoch nur dann geschuldet, wenn dadurch nicht in das betreibungsrechtliche Existenzminimum des Unterhaltspflichtigen eingegriffen wird.
- Bei lebensprägender Ehe (wie Ehedauer über 10 Jahren und/oder gemeinsame Kinder; Entwurzelung aus dem bisherigen Kulturkreis) wird auf den zuletzt in der Ehe gelebten Lebensstandard abgestellt, d.h. beide Ehegatten sollen nach der Scheidung möglichst in gleichen Verhältnissen weiterleben dürfen wie während der Ehe. Ist eine Arbeitsaufnahme des unterhaltsberechtigten Ehegatten nicht zumutbar, ist der Unterhalt unter Umständen sogar bis zur Pensionierung geschuldet. Durch den nachehelichen Unterhalt soll der sog. ehebedingte Nachteil ausgeglichen werden. Wenn z.B. der Ehemann sich um Kinder und Haushalt gekümmert hat und dadurch eine Erwerbs- und damit eine Karriereeinbusse hinnehmen musste, soll die Ehefrau, welche ihre Karriere während der Ehe fördern konnte, den Ehemann nach der Ehe unterstützen (nacheheliche Solidarität).
- War die Ehe nicht lebensprägend (kurze Ehedauer [unter 5 Jahren], keine Kinder), ist selten ein Unterhaltsbeitrag geschuldet, da meist beide Ehegatten während der Ehe weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind und damit keinen ehebedingten Nachteil erlitten haben.
8. Ich war während der Ehe für den Haushalt (und die Kinder) zuständig und ging keiner Erwerbstätigkeit nach bzw. nur in einem kleinen Pensum. Muss ich nach der Scheidung wieder bzw. mehr arbeiten?
Grundsätzlich gilt, dass jeder Ehegatte einer Erwerbstätigkeit nachgehen muss, sofern dies zumutbar ist. Geht ein Ehegatte keiner Erwerbstätigkeit nach, obwohl dies zumutbar wäre, wird ihm bei der Unterhaltsberechnung ein hypothetisches Einkommen (das bei einer Erwerbstätigkeit erzielt werden könnte) angerechnet.
- Für den hauptbetreuenden Elternteil minderjähriger Kinder gelten im Kanton Luzern folgende Grundsätze für dessen Erwerbstätigkeit:
- unter Umständen bereits ab Eintritt des jüngsten Kindes in den Kindergarten: Erwerbspensum von 20-30% zumutbar,
- ab Eintritt des jüngsten Kindes in die Primarschule: Erwerbspensum von 40-50% zumutbar,
- ab Eintritt des jüngsten Kindes in die Oberstufe: Erwerbspensum von 70-80% zumutbar,
- wenn das jüngste Kind 16 Jahre alt ist: Erwerbspensum von 100% zumutbar.
- Eine vollständige Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit nach der Scheidung bzw. Trennung wird bei einem Alter zwischen 45 und 50 Jahren (Zeitpunkt der definitiven Trennung massgebend) als nicht mehr realistisch und damit unzumutbar erachtet. Eine Erhöhung des Arbeitspensums (falls der Ehegatte auch während der Ehe in einem Teilzeitpensum gearbeitet hat) kann jedoch auch in diesem Alter verlangt werden. Sind zum Zeitpunkt der Trennung minderjährige Kinder zu betreuen, so ist für die Zumutbarkeit des beruflichen Wiedereinstiegs auf den Zeitpunkt des Wegfalls der Betreuungspflichten abzustellen.
- Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen, welche vor der Scheidung aufgetreten sind, kann unter Umständen eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit unzumutbar sein.
9. Wer darf in der ehelichen Wohnung/im Haus bleiben?
In der Regel geht der Scheidung eine Zeit des Getrenntlebens voraus und es besteht daher bereits eine vorläufige Zuteilung der ehelichen Wohnung/des Hauses. Entscheidend für die definitive Zuweisung der Wohnung/des Hauses ist das praktische Bedürfnis der Ehegatten, d.h. wem die Wohnung/das Haus mehr nützt oder wem der Auszug leichter fällt (Art. 121 ZGB). Hingegen selten von Belang ist die Frage, wer Mieter der Liegenschaft ist. Berücksichtigt wird insbesondere, wer mit den unmündigen Kindern zusammenlebt, da die Kinder nicht gezwungen werden sollen, ihr vertrautes Umfeld zu verlassen. Ausserdem stellt sich die Frage, ob ein Ehegatte beruflich auf die Wohnung/das Haus angewiesen oder persönlich eng mit der Wohnung/dem Haus verbunden ist (z.B. bei tiefer Verwurzelung oder bei einer aufgrund der Invalidität eines Ehegatten umgebauten Wohnung).
Steht die Liegenschaft allerdings im Alleineigentum eines Ehegatten, kann das Gericht an den Eigentumsverhältnissen nichts ändern. Eine gerichtliche Übertragung des Eigentums auf den anderen Ehegatten ist ausgeschlossen. Das Gericht kann jedoch dem Ehegatten, der nicht Eigentümer der Liegenschaft ist, jedoch darin verbleiben möchte, unter den gleichen Voraussetzungen und gegen angemessene Entschädigung oder unter Anrechnung auf Unterhaltsbeiträge ein befristetes Wohnrecht einräumen (Art. 121 Abs. 3 ZGB).
10. Was wird mit der Scheidung auch noch geregelt?
Mit der Scheidung werden auch die Scheidungsfolgen geregelt. Dazu gehören – neben elterlicher Sorge/Obhut/persönlicher Verkehr/Betreuungsanteile, Unterhalt und ehelicher Wohnung/Haus – insbesondere die güterrechtliche Auseinandersetzung (Aufteilung des Vermögens) sowie der Vorsorgeausgleich (berufliche Vorsorge [BVG]).
- Güterrechtliche Auseinandersetzung: Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gelten die Bestimmungen nach Art. 181 ff. ZGB. Haben die Ehegatten keinen Ehevertrag abgeschlossen und nach dem 01. Januar 1988 geheiratet, so gilt der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 197 ff. ZGB). Dies bedeutet für die Scheidung kurz zusammengefasst, dass jeder Ehegatte sein sog. Eigengut (persönliche Gegenstände, Erbschaften, Schenkungen, Ersparnisse von vor der Ehe) behält und die sog. Errungenschaft (v.a. Erwerbseinkommen während der Ehe, Dividenden, Zinsen) eines jeden Ehegatten hälftig geteilt wird.
- Vorsorgeausgleich (Art. 122 ff. ZGB): Hatten die Ehegatten während der Ehe eine klassische Aufgabenteilung (ein Ehegatte ist erwerbstätig, der andere kümmert sich um Haushalt und Kinder), bzw. war ein Ehegatte voll erwerbstätig und der andere bloss teilzeitlich, so konnte sich der (voll) erwerbstätige Ehegatte während der Ehe eine wesentlich bessere berufliche Vorsorge aufbauen als der nicht (voll) erwerbstätige Ehegatte. Im Rahmen der Scheidung wird deshalb in der Regel die während der Ehe angesparte Austrittsleistung beider Ehegatten hälftig geteilt.
Arbeitsrecht
1. Wie gelangt man vom Monatslohn zum Tages- bzw. Stundenlohn?
In aller Regel wird der Lohn als Monatslohn vereinbart. Müssen einzelne Tage entschädigt werden, stellt sich die Frage, wie der Monatslohn in den Tageslohn umzurechnen ist. Hierfür gibt es zwei Methoden:
- Berechnung nach Kalendertagen:
Der Monatslohn wird durch die Anzahl Kalendertage des betreffenden Monats geteilt. Es resultiert der Lohn pro Kalendertag;
- Berechnung nach Arbeitstagen (kommt grundsätzlich immer dann zur Anwendung, wenn keine besonderen Berechnungsvorschriften vorliegen):
Der Monatslohn wird durch die durchschnittliche Anzahl Arbeitstage pro Monat geteilt. Ein Jahr hat 52 Wochen und entsprechend 52 mal 5 Arbeitstage (ohne Feiertage), somit 260 Arbeitstage (261, wenn der 365. Tag dazugerechnet wird). Teilt man diese Zahl durch 12, erhält man die durchschnittliche Anzahl Arbeitstage pro Monat, nämlich 21.75 (bzw. 21.67, wenn man von 261 Tagen ausgeht). Der Tageslohn berechnet sich alsdann aus dem Mo-natslohn geteilt durch 21.75 (bzw. 21.67).
Im Gegensatz zu den Löhnen, werden Arbeitszeiten oftmals pro Woche festgelegt. Insofern stellt sich die Frage, wie der Monatslohn in den Stundenlohn umzurechnen ist. Hierfür geht man wiederum von 52 Wochen pro Jahr aus. Entsprechend hat ein durchschnittlicher Monat 4.333 Wochen (52/12). Die Monatsarbeitszeit ergibt sich alsdann als Wochenarbeitszeit mal 4.333 und der Stundenlohn entsprechend als Monatslohn geteilt durch die Monatsarbeitszeit.
Beispiel:
Ein AN verdient monatlich CHF 11‘500.00, wobei er im Rahmen einer 5-Tage-Woche 42 Stunden pro Woche arbeiten muss:
Tageslohn:
CHF 11‘500.00 / 21.75 = CHF 528.75
Stundenlohn:
42 x 4.333 = 182 (Arbeitsstunden pro Monat; gerundet)
CHF 11‘500.00 / 182 = CHF 63.20
2. Wie ist der Ferienanspruch bei unterjährigem Arbeitsverhältnis und bei Beendigung während des Dienstjahres (oder Kalenderjahres) zu berechnen?
Da der Ferienanspruch mit der Anstellungsdauer wächst, pro rata temporis nach folgender Empfehlung des SECO:
|
Ferientage pro Monat (= 1/12 des Ferienguthabens in Arbeitstagen gerechnet) |
|||||
|
Ferienwochen pro Dienstjahr |
6-Tage- |
5½-Tage- |
5-Tage- |
4½-Tage- |
4-Tage- |
|
4 Wochen |
2.00 |
1.83 |
1.66 |
1.50 |
1.33 |
|
5 Wochen |
2.50 |
2.29 |
2.08 |
1.87 |
1.66 |
|
6 Wochen |
3.00 |
2.75 |
2.50 |
2.25 |
2.00 |
Sollten sich bei der Berechnung Bruchteile ergeben, so sind diese nach den allgemeinen Regeln auf halbe oder ganze Ferientage auf- oder abzurunden, zumal kürzere Ferien als halbe Tage nicht gewährt werden sollten.
3. Welche Ferienkürzungen sieht das Obligationenrecht vor?
- Verschuldete Verhinderung (Art. 329b Abs. 1 OR):
Sofern der AN während eines Dienstjahres mehr als einen Monat an der Arbeitsleistung verhindert war, so kann der AG den Ferienanspruch für jeden vollen Monat um einen Zwölftel kürzen. Entsprechend besteht grundsätzlich (vgl. aber die Ausführungen im Beispiel) eine Schonfrist von einem Monat.
Relevant ist nur ein schweres Verschulden, z.B. Arbeitsverhinderung durch Unfall infolge Fahrens in angetrunkenem Zustand;
- Schuldlose Verhinderung durch persönliche Gründe wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten, Ausübung eines öffentlichen Amtes oder Jugendurlaub (Art. 329b Abs. 2 OR):
In solchen Fällen ist die Ferienkürzung einseitig zwingend erst vom zweiten vollen Monat der Arbeitsverhinderung an vorzunehmen. Entsprechend besteht eine Schonfrist von einem Monat;
- Verhinderung wegen Schwangerschaft oder Bezug der Mutterschaftsentschädigung (Art. 329b Abs. 3 OR):
Keine Kürzung der Ferien darf nach der einseitig zwingenden Regelung erfolgen, wenn eine AN wegen Schwangerschaft bis zu zwei Monaten an der Arbeitsleistung verhindert ist (insofern gilt eine Schonfrist von zwei Monaten) oder weil sie die Mutterschaftsentschädigung gemäss EOG bezogen hat.
Beispiel:
Eine dreieinhalbmonatige Verhinderung führt zu einer Kürzung des Ferienanspruchs
- bei verschuldeter Verhinderung: 3/12;
- bei unverschuldeter Verhinderung: 2/12;
- bei schwangerschaftsbedingter Verhinderung: 1/12;
- bei Bezug der Mutterschaftsentschädigung: Keine Kürzung.
In den Fällen von Art. 329b Abs. 2 und 3 OR findet – im Unterschied zu Abs. 1 – nach herrschender Lehre keine Anrechnung der in die Schonfrist fallenden Monate für die Ferienkürzung statt.
4. Wie ist die Ferienkürzung zu berechnen?
Nach den Grundsätzen, wie sie in Frage 3 festgehalten sind.
Bei einer 5-Tage-Arbeitswoche beträgt das Kürzungsmass pro vollem Monat der Arbeitsverhinderung und
- vier Wochen Ferien: 1.66 Tage,
- fünf Wochen Ferien: 2.08 Tage sowie
- sechs Wochen Ferien: 2.50 Tage.
Beispiel:
Ein AN hat einen Ferienanspruch von 5 Wochen und arbeitet fünf Tage pro Woche. Im Dienstjahr war er 88 Tage zu 100 % arbeitsunfähig infolge Krankheit. Die Ferienkürzung beträgt:
88 (Arbeitsunfähigkeitstage) – 21.75 (Schonfristtage; ein Monat hat bei einer 5-Tage-Woche durchschnittlich 21.75 Arbeitstage) = 66.25 (Kürzungstage)
66.25 (Kürzungstage) / 21.75 (durchschnittliche Arbeitstage pro Monat) = 3.046 (Kürzungsmonate)
3 (volle Kürzungsmonate) x 2.08 (Kürzungstage pro vollem Monat) = 6.24 Kürzungstage
Der Ferienanspruch kann abgerundet um 6 Tage gekürzt werden.
5. Unter welchen Voraussetzungen muss der AN Überstundenarbeit leisten?
Nach Art. 321c Abs. 1 OR nur unter folgenden, kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen: Überstundenarbeit
- muss notwendig sein,
- darf die (physische und psychische) Leistungsfähigkeit des AN nicht übersteigen und
- muss dem AN nach Treu und Glauben zugemutet werden können.
Darüber hinaus müssen die Schutzvorschriften des Arbeitsgesetzes hinsichtlich wöchentlicher Höchstarbeitszeit, Überzeitarbeit, freier Tage und Pausen sowie jene über Tages-, Abend-, Nacht- und Sonntagsarbeit beachtet werden
6. Wann und wie ist Überstundenarbeit abzugelten?
Abzugelten sind geleistete Überstunden,
- welche vom AG angeordnet wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie notwendig waren oder nicht;
- gegen welche der AG trotz Kenntnis nicht einschreitet bzw. keinen Einspruch erhebt (sie sind angeordneten Überstunden gleichzusetzen und gelten als nachträglich genehmigt);
- welche nicht angeordnet wurden, sofern sie objektiv notwendig waren oder vom AN nach Treu und Glauben als notwendig betrachtet werden durften.
Überstundenarbeit wird abgegolten:
- Grundsätzlich durch Lohn, welcher nach dem Normallohn mit einem Zuschlag von mind. einem Viertel bemessen wird (Art. 321c Abs. 3 OR), wobei sich Fälligkeit und Verjährung nach den allgemeinen, für den Lohnanspruch geltenden Bestimmungen richten (Art. 323, 128 Ziff. 3 OR);
- Mit Einverständnis (auch stillschweigendem) des AN kann der AG die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraums (i.d.R. innerhalb max. 14 Wochen) durch Freizeit von mind. gleicher Dauer ausgleichen (Art. 321c Abs. 2 OR). Versucht der AG eine Kompensation gegen den Willen des AN durchzusetzen, gerät er in Annahmeverzug (Art. 324 OR);
- Durch schriftliche Abrede, Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag kann eine andere – auch eine für den AN ungünstigere – Lösung getroffen werden (Art. 321c Abs. 2 OR). Namentlich kann der Lohnzuschlag, aber auch die Vergütung von Überstundenarbeit als solche, ausgeschlossen werden, wobei die bloss mündliche Wegbedingung des Überstundenlohnes nicht wirksam ist. Grenze für einen Ausschluss der Überstundenvergütung ist die Überzeit. Wird die Überstundenarbeit durch Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit zur Überzeitarbeit, dann wird der Zuschlag, soweit Art. 13 ArG anwendbar ist, zwingend, zumal Art. 13 ArG abweichende Vereinbarungen nicht zulässt (Art. 342 Abs. 2 OR).
7. Kann einem erkrankten AN gekündigt werden?
Eine Kündigung erfolgt u.a. zur Unzeit, wenn sie ausgesprochen wird, während der AN ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen (Art. 336c Abs. 1 lit. b OR). Bei diesen Sperrfristen handelt es sich um Kalendertage. Entsprechend läuft eine Sperrfrist ab erstem Tag der Arbeitsunfähigkeit (BGE 133 III 517).
Gemäss Art. 336c Abs. 2 1. Halbsatz OR ist eine in die Sperrfrist fallende Kündigung nichtig und entfaltet daher keinerlei Rechtswirkung. Abzustellen ist auf den Zugang der Kündigung. Sofern am Kündigungswillen festgehalten wird, muss das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Sperrfrist nochmals gekündigt werden.
Ist die Kündigung vor Beginn einer Sperrfrist zugegangen, so ist sie wirksam. Falls die Kündigungsfrist bis zum Beginn der Sperrfrist hingegen noch nicht abgelaufen ist, so wird ihr Lauf gemäss Art. 336c Abs. 2 2. Halbsatz OR unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. Bei Verhinderungen infolge Krankheit oder Unfall erfolgt die Unterbrechung und Verlängerung nur hinsichtlich der effektiven Krankheits- bzw. Unfalltage. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung von kürzerer Dauer verlängert die Kündigungsfrist entsprechend nicht um 30, 90 oder 180 Tage. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was zu gelten hat, wenn durch die Unterbrechung bewirkt wird, dass die Kündigungsfrist zu einem anderen als dem gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungstermin ausläuft? Gemäss Art. 336c Abs. 3 OR wird die Kündigungsfrist auf den nächstfolgenden Endtermin (insbesondere Ende eines Monats oder eine Arbeitswoche) verlängert.
Beispiel:
Ein sich im ersten Dienstjahr befindender AN erhält am 27. September auf den 31. Oktober die Kündigung. Er ist vom 10. Oktober bis am 15. Oktober krank. Die Kündigungsfrist beginnt am 01. Oktober zu laufen und läuft bis zur Erkrankung neun Tage. Die restlichen 22 Tage (der 31 Oktobertage) laufen vom 16. Oktober bis am 06. November. Da das Ende der erstreckten Kündigungsfrist nicht auf das Monatsende fällt, verlängert sie sich bis zum 30. November.
Zu beachten ist, dass auch Kurzabsenzen zu einer Unterbrechung und Verlängerung der Sperrfrist führen, mit der Folge, dass die Kündigungsfrist gemäss Art. 336c Abs. 3 OR um nahezu einen Monat verlängert wird, wenn als Endtermin das Monatsende gilt. Vorbehalten bleibt das Rechtsmissbrauchsverbot.
Das Verlängerungsproblem lässt sich dadurch lösen, dass im Arbeitsvertag die Kündigungsmöglichkeit «auf jeden beliebigen Zeitpunkt» und nicht auf einen festen Termin (Monatsende) vorgesehen wird. Ein bestimmter Kündigungstermin ist nämlich nicht zwingend vorgeschrieben.
Der Kündigungsschutz greift auch bei geringfügigen Erkrankungen. Er kommt nur dann nicht zur Anwendung, wenn die Beeinträchtigung sich als so unbedeutend erweist, dass sie der Stellensuche bzw. dem Antritt einer neuen Stelle in keiner Weise entgegensteht (BGE 128 III 212).
Der Kündigungsschutz greift ferner auch dann, wenn der AN
- trotz Krankschreibung arbeiten geht,
- seine Arbeitsunfähigkeit dem AG treuepflichtwidrig nicht mitteilt oder
- sich seines Krankheitszustands noch gar nicht bewusst ist.
Massgebend ist demzufolge grundsätzlich weder die Kenntnis der Krankheit noch deren Schweregrad oder der Umstand, dass effektiv keine Arbeit geleistet wird, sondern ob die Krankheit den Antritt einer neuen Stelle unwahrscheinlich werden lässt.
8. Welcher gesetzliche Kündigungstermin ist vorgesehen?
Gemäss Art. 335c Abs. 1 OR ist der Zeitpunkt, auf welchen hin gekündigt werden kann, das Ende eines Monats.
Die Lage der jeweiligen Kündigungsfrist ergibt sich sodann durch Rückrechnung vom Kündigungstermin. Die Kündigungsfrist beginnt insofern nicht mit dem Zugang der Kündigung, sondern erst am folgenden Monatsanfang zu laufen (BGE 134 III 354). Fällt der Kündigungstermin auf einen Sonn- oder Feiertag, so verschiebt er sich nicht auf den nächstfolgenden Werktag.
Beispiele:
- Bei einer Kündigung am 6. März mit einer zweimonatigen Kündigungsfrist auf den 30. Juni, läuft die Kündigungsfrist vom 1. Mai bis am 30. Juni. Die Kündigung müsste spätestens am 30. April zugehen.
- Bei einer Kündigung am 12. Oktober mit einer einmonatigen Kündigungsfrist auf den 30. November läuft die Kündigungsfrist vom 1. November bis am 30. November. Die Kündigung müsste in diesem Beispiel spätestens am 31. Oktober zugehen;
Bedeutsam ist das Rückrechnungsprinzip namentlich dann, wenn der Lauf der Kündigungsfrist durch eine Sperrfrist i.S.v. Art. 336c OR (z.B. Krankheit) unterbrochen wird.
9. Ist der gesetzliche Kündigungstermin vertraglich abänderbar?
Ja, es kann z.B. eine Kündigung auf einen beliebigen Termin vereinbart werden. Damit kann vermieden werden, dass eine Kurzerkrankung während der Kündigungsfrist zu einer Verlängerung der Kündigungsfrist bis zum nächsten Monatsende führt (vgl. Art. 336c Abs. 3 OR).
Umstritten ist hingegen, ob dies formlos möglich ist oder ebenfalls der Schriftform bedarf. Insofern empfiehlt sich die Einhaltung der Schriftform.
10. Welche Verfahrensvorschriften sind bei der Geltendmachung einer Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung i.S.v. Art. 336a OR einzuhalten?
Gemäss dem beidseitig zwingenden Art. 336b OR muss der Gekündigte
- bis zum Ende der Kündigungsfrist (Eintritt des Kündigungstermins) schriftlich Einsprache erheben und
- sofern keine Einigung über die Fortsetzung erfolgt, innert 180 Tagen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Klage anhängig machen.
Die Einsprachefrist ist dabei gewahrt, wenn die Einsprache am letzten Tag des Arbeitsverhältnisses der Gegenpartei zugeht – der Poststempel ist folglich nicht massgebend (Empfangsprinzip).
Die Einsprachefrist gilt auch während der Probezeit. Wird die gesetzliche Kündigungs- und damit auch Einsprachefrist von sieben Tagen i.S.v. Art. 335b Abs. 2 OR verkürzt oder gar wegbedungen (entfristete Kündigung), so ist hingegen jeweils einzelfallweise zu prüfen, ob die Einsprache während der verkürzten Frist möglich und zumutbar ist. Das Bundesgericht lehnt es ab, diesfalls generell von einer siebentägigen Einsprachefrist auszugehen (BGE 136 III 96; in casu wurden Möglichkeit und Zumutbarkeit bei eine Einsprachefrist von drei Tagen bejaht).
An die Formulierung der Einsprache werden keine hohen Anforderungen gestellt. Es genügt, wenn die betroffene Partei gegenüber dem Kündigenden schriftlich zum Ausdruck bringt, mit der Kündigung nicht einverstanden zu sein (BGE 123 III 246). Die Einsprache muss weder begründet werden noch einen bestimmten Missbrauchsgrund nennen.
Gemäss herrschender Lehre genügt die Klageerhebung innerhalb der Kündigungsfrist (Einreichung des Schlichtungsgesuchs: Art. 62 ZPO) dem Erfordernis der Einsprache – es braucht diesfalls keine zusätzliche vorgängige Einsprache. Dies gilt aber nicht auch für eine Betreibung.
Erfolgt die Einsprache oder Klage nicht frist- und/oder formgerecht, so ist der Entschädigungsanspruch verwirkt. Dass Rechtssuchende, welche über die speziellen und strengen Verfahrensvorschriften nicht orientiert sind, zu Opfern derselben werden können, nahm der Gesetzgeber im Interesse der Rechtssicherheit in Kauf.
Altersfragen
1. Was ist ein Vorsorgeauftrag?
Mittels Vorsorgeauftrag kann eine handlungsfähige – d.h. urteilsfähige und mündige – Person selbst bestimmen, durch wen und wie sie im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit betreut werden will. Die Betreuung kann dabei die Personen- und Vermögenssorge sowie die Vertretung in rechtlichen Angelegenheiten umfassen. Insgesamt ermöglicht ein Vorsorgeauftrag folglich Selbst- statt Fremdbestimmung.
Urteilsunfähig sind dabei Personen, welche infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rauschzuständen oder ähnlichem die Fähigkeit zum vernunftgemässen handeln nicht mehr haben. Dies kann nach einem Unfall oder einer schweren Erkrankung ebenso der Fall sein, wie bei einer Altersdemenz.
Geht die Urteilsfähigkeit verloren, wird die KESB die im Vorsorgeauftrag aufgeführte Person anstelle eines Beistandes für die Betreuung einsetzen. Die permanente Aufsicht durch die KESB entfällt alsdann.
2. Wie ist ein Vorsorgeauftrag zu verfassen?
Er ist eigenhändig niederzuschreiben (inkl. Datum und Unterschrift) oder öffentlich durch einen Notar zu beurkunden.
3. Was sollte hinsichtlich des Inhalts eines Vorsorgeauftrags beachtet werden?
- Die einfachste Variante ist, für alle Angelegenheiten eine einzige Vertretungsperson zu bezeichnen. Man kann jedoch auch pro Angelegenheit (Personensorge, Vermögenssorge, Rechtsverkehr) je eine andere Vertretungsperson bezeichnen.
- Man sollte unbedingt nicht nur eine Vertretungsperson, sondern auch eine Ersatzvertretungsperson bezeichnen, für den Fall dass die erstbeauftragte Person z.B. selbst urteilsunfähig oder nicht auffindbar ist.
- Mindestinhalt:
a) Wichtig ist, dass der/die Auftraggeber(in) und die Vertretungsperson (sowie Ersatzvertretungsperson) klar bestimmt sind (Name und Wohnort).
b) Des Weiteren muss klar festgehalten werden, dass der Auftrag erst mit Eintritt der Urteilsunfähigkeit des Auftraggebers Wirkung entfaltet.
c) Schliesslich muss der Aufgabenbereich der Vertretungsperson zumindest generell umschrieben werden, da sonst von einem umfassenden Vorsorgeauftrag ausgegangen wird (für Personen-, Vermögenssorge und Rechtsverkehr).
- Geregelt werden kann auch eine angemessene Entschädigung, welche der beauftragten Person für ihre Leistungen zukommen soll. Wird dies vom Auftraggeber im Vorsorgeauftrag nicht geregelt, so wird bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit allenfalls eine angemessene Entschädigung von der Erwachsenenschutzbehörde festgesetzt.
- Das Zivilstandsamt trägt auf Antrag die Tatsache, dass eine Person einen Vorsorgeauftrag errichtet hat, und den Hinterlegungsort in eine zentrale Datenbank ein.
- Der Vorsorgeauftrag kann jederzeit widerrufen und gegebenenfalls ein neuer verfasst werden. Auch der Widerruf muss jedoch handschriftlich verfasst werden.
4. Wer hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen?
Ergänzungsleistungen können gemäss Art. 4 ff. ELG Personen erhalten, welche
- einen Anspruch auf eine Rente der AHV (auch bei Rentenvorbezug), eine Rente der IV (ganze, Dreiviertels-, halbe oder Viertelsrente), oder nach Vollendung des 18. Altersjahres eine Hilflosenentschädigung der IV beziehen oder während mindestens sechs Monaten ein Taggeld der IV erhalten,
- in der Schweiz Wohnsitz und tatsächlichen Aufenthalt haben (Exportverbot: Entsprechend kann z.B. eine Schweizer AHV-Rentnerin, welche ihren Lebensabend in Brasilien verbringen will, nicht auf Ergänzungsleistungen zählen; dies gilt auch für EU- und EFTA-Mitgliedstaaten),
- BürgerIn der Schweiz sind (berechtigt sind auch AusländerInnen, welche seit mindestens 10 Jahren ununterbrochen in der Schweiz leben, Flüchtlinge und Staatenlose, welche seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen in der Schweiz leben sowie i.d.R. ohne Karenzfrist EU- und EFTA-AusländerInnen) und
- deren anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen.
5. Wie hoch sind die Ergänzungsleistungen?
Jährliche Ergänzungsleistungen, welche monatlich zur Auszahlung kommen, entsprechen der Differenz zwischen den anerkannten Ausgaben und den anrechenbaren Einnahmen einer versicherten Person. Was zu den anerkannten Ausgaben gezählt wird, ist in Art. 10 ELG geregelt, was zu den anrechenbaren Einnahmen in Art. 11 ELG.
Zumal Ergänzungsleistungen die Deckung der laufenden Lebensbedürfnisse bezwecken, dürfen grundsätzlich nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte berücksichtigt werden, über welche die leistungsansprechende Person ungeschmälert verfügen kann. Vorbehalten bleibt aber der Tatbestand des Vermögensverzichts: Als Einnahmen werden nämlich gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG auch Einkünfte und Vermögenswerte angerechnet, auf welche verzichtet worden ist.
6. Wie werden Einkünfte und Vermögenswerte behandelt, auf welche verzichtet wurde?
Als Einnahmen werden auch Einkünfte und Vermögenswerte angerechnet, auf welche verzichtet worden ist (Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG).
Die Anrechnung des Einkommens- und Vermögensverzichts dient vordergründig der Verhinderung von Rechtsmissbräuchen – Leistungsansprechende sollen nicht zulasten der Versicherung auf Einkommen verzichten oder sich vorhandener Vermögenswerte entäussern. Damit ist Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG auch Ausdruck der ergänzungsleistungsspezifischen Schadenminderungspflicht, gemäss welcher Leistungsansprechende ihren Existenzbedarf soweit möglich und zumutbar aus eigener Kraft bestreiten müssen.
Das Gesetz führt hingegen nicht aus, unter welchen Voraussetzungen ein anrechenbarer Vermögensverzicht gegeben ist. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 134 I 65, E. 3.2; 131 V 329, E. 4.2) erfolgt eine Anrechnung, wenn
- ohne rechtliche Verpflichtung (z.B. ein Erbvorbezug; Die Erfüllung einer moralischen Pflicht genügt nicht) und
- ohne adäquate Gegenleistung (z.B. Schenkung einer Liegenschaft)
auf Einkünfte oder Vermögen verzichtet wurde. Dabei sind die beiden Voraussetzungen alternativ zu verstehen.
7. Welche allgemeinen Grundsätze gilt es bei der Anrechnung eines Einkommens- und Vermögensverzichts zu beachten?
- Praxisgemäss ist eine Gegenleistung gleichwertig, wenn ihr Wert mind. 90 % des Leistungswerts beträgt. Diesfalls findet keine Anrechnung statt.Massgebend ist eine wirtschaftliche, materielle Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung. Die Prüfung erfolgt nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen von Art. 17 ELV auf den Zeitpunkt der Entäusserung hin. Allfällige spätere Wertsteigerungen bleiben in aller Regel unberücksichtigt.
- Ist die Gegenleistung nicht gleichwertig, entspricht die Höhe des Verzichtseinkommens bzw. -vermögens der Differenz zwischen Leistung und Gegenleistung.
- Zusätzlich zum Vermögensverzicht können die Zinserträge, die auf dem Verzichtsvermögen erzielbar gewesen wären, als Einnahmen angerechnet werden.
- Auf ein vorsätzliches Handeln bzw. eine Schädigungsabsicht kommt es für die Anrechnung nicht an.
- Vermögens- bzw. Einkommensverzichte verjähren nicht. Insofern können die Behörden auch Verzichte, welche zehn, zwanzig und mehr Jahre zurückliegen berücksichtigen.
- Der anzurechnende Betrag wird beim Vermögensverzicht (nicht hingegen auch beim Einkommensverzicht) jährlich – erstmals im 2. Jahr nach dem Verzicht – um CHF 10‘000.- vermindert, wodurch sich die Folgen des Vermögensverzichts für die leistungsansprechende Person laufend lindern (Art. 17a ELV).
- Ein Rentenvorbezug i.S.v. Art. 40 AHVG wird gemäss Art. 15a ELV nicht als Einkommensverzicht gewertet.
8. Wie wird ein Erbvorbezug (dasselbe gilt bei Schenkungen) als Vermögensverzicht bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen berücksichtigt?
Beispiel:
Herr Käch (alleinstehend) gewährt seiner Tochter am 20.07.2008 einen Erbvorbezug von CHF 160‘000.- für einen Hauskauf. 2017 muss er ins Pflegeheim und meldet sich, angesichts der hohen Heimkosten und seinen dafür nicht ausreichenden Altersrenten, zum Ergänzungsleistungsbezug an.
Merke:
Da keine gesetzliche Pflicht für den Erbvorbezug besteht und auch keine Gegenleistung erfolgte, wird die zuständige Ergänzungsleistungsstelle den Erbvorbezug als Vermögensverzicht qualifizieren.
Angerechnet werden per 1. Januar (vgl. Art. 17a ELV):
- 2009: CHF 160‘000.- (unverändert)
- 2010: CHF 150‘000.- (erstmalige Reduktion um CHF 10‘000.-)
- 2011: CHF 140‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2012: CHF 130‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2013: CHF 120‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2014: CHF 110‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2015: CHF 100‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2016: CHF 90‘000.- (jährliche Reduktion)
- 2017: CHF 80‘000.- Verzichtsvermögen per EL-Anmeldung
Zu berücksichtigendes Vermögen per EL-Anmeldung:
| Vermögensverzicht: | CHF 80‘000.- | |
| + übriges Vermögen: | CHF 20‘000.- | (Annahme) |
| - Freibetrag Alleinstehende: | CHF 37‘500.- | (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG) |
| relevantes Vermögen: | CHF 62‘500.- |
Anrechnung als Vermögensverzehr: 1/10* von CHF 62‘500.- = CHF 6‘250.- (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG).
*Da Herr Käch Altersrentner ist – sonst 1/15. Zu beachten ist, dass gemäss Art. 11 Abs. 2 ELG die Kantone den Vermögensverzehr für in Heimen oder Spitälern lebende Personen auf höchstens 1/5 erhöhen können. So sieht z.B. § 5 des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV des Kantons Luzern (SRL 881) vor, dass der Vermögensverzehr für in Heimen oder Spitälern lebende Personen 1/5 beträgt.
Vorbehältlich eines weiteren Verzichts reduzieren sich die CHF 80‘000.- jährlich um weitere CHF 10‘000.-. Der Verzicht wird also nicht unendlich mitgetragen, sondern ist in unserem Beispiel nach einigen Jahren «getilgt». Zudem wird der Ertrag, welcher aus dem verzichteten Vermögen erzielbar wäre, als Einnahme angerechnet: Wenn wir von einer durchschnittlichen Verzinsung von 0.1 % ausgehen, wären CHF 80.- (CHF 80’000.- / 1’000) anzurechnen. Dieser Betrag reduziert sich in den Folgejahren entsprechend. Bei gleichbleibender Verzinsung werden im nächsten Jahr folglich CHF 70.- (CHF 70‘000.- / 1‘000) und im übernächsten Jahr CHF 60.- (CHF 60‘000.- / 1‘000) usw. angerechnet.
9. Wie wird eine gemischte Schenkung einer Liegenschaft gegen Einräumung einer lebenslänglichen Nutzniessung bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen berücksichtigt?
Beispiel:
Herr Dubach (alleinstehender AHV-Rentner) besitzt ein selbst bewohntes Einfamilienhaus, welches er an seinem 64. Geburtstag seinem Sohn überschreibt. Dieser übernimmt die Hypotheken und Herr Dubach behält die lebenslängliche Nutzniessung am Haus und kommt für die Hypothekarzinsen sowie den Gebäudeunterhalt auf.
I. Berechnung des Kapitalwerts der Nutzniessung
1. Ermittlung des Kapitalisierungsfaktors
Der Kapitalisierungsfaktor wird anhand folgender Formel bestimmt (BGE 122 V 394, E. 4b):
| CHF 1‘000.- | |
| Kapitalisierungsfaktor = | |
| Jahresrente gemäss Tabelle* |
*Eidg. Steuerverwaltung ESTV: Tabelle zur Umrechnung von Kapitalleistungen in lebenslängliche Renten – Werte ab dem Jahr 2005; zu finden auf https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/tarife.html
Alter der begünstigten Person: 64
Jahresrente gemäss Tabelle: 49.18
Kapitalisierungsfaktor: 20.33 (CHF 1‘000.-/49.18)
2. Kapitalwertberechnung
| Bruttojahreswert: | CHF 30‘000.- | (= Marktmietwert)* |
| - Hypothekarzinsen: | CHF 2‘400.- | (Annahme 1.2%) |
| - Gebäudeunterhaltskosten: | CHF 3‘000.- | (Pauschalabzug von 10%)** |
| Nettojahreswert: | CHF 24‘600.- |
Kapitalwert: CHF 500‘118.- (Nettojahreswert CHF 24‘600 x Kapitalisierungsfaktor 20.33)
*Mittlerer Mietzins für vergleichbare Objekte an vergleichbarer Lage.
**Massgebend für Gebäude, welche noch nicht 10 Jahre alt sind; für ältere Gebäude gilt grundsätzlich ein Pauschalabzug von 20%.
II. Höhe des Vermögensverzichts
Höhe der Leistung:
| Liegenschaft | CHF 950‘000.- | (= Verkehrswert)* |
| Total | CHF 950‘000.- |
*Vgl. Art. 17 Abs. 5 ELV; massgebend ist der aktuelle Marktwert. Ist dieser nicht bekannt, so ist auf den Mittelwert zwischen dem Wert nach kantonaler Steuergesetzgebung über die direkte Kantonssteuer und dem Gebäudeversicherungswert abzustellen, sofern dies nicht offensichtlich zu einem unrichtigen Ergebnis führt.
Höhe der Gegenleistung:
| Nutzniessung | CHF 500‘118.- | |
| + Übernahme Hypotheken | CHF 200‘000.- | (Annahme) |
| Total | CHF 700‘118.- |
Höhe des Vermögensverzichts:
| Wert der Leistung | CHF 950‘000.- | |
| - Wert der Gegenleistung | CHF 700‘118.- | (73.70% der Leistung)* |
| Verzichtsvermögen | CHF 249‘882.- |
*Da der Wert der Gegenleistung weniger als 90 % der Leistung beträgt, wird die Gegenleistung nicht als geleichwertig betrachtet und es liegt ein anrechenbares Verzichtsvermögen vor.
III. Anrechenbarer Betrag
| Vermögensverzicht: | CHF 249‘882.- | |
| - Freibetrag Alleinstehende: | CHF 37‘500.- | (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG) |
| relevantes Vermögen: | CHF 212‘382.- |
Anrechnung als Vermögensverzehr: 1/10* von CHF 212‘382.- = CHF 21‘238.20 (Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG).
*Da Herr Dubach Altersrentner ist – sonst 1/15.
Vorbehältlich eines weiteren Verzichts reduzieren sich die CHF 249‘882.- jährlich – ab dem 2. Jahr nach dem Verzicht – um CHF 10‘000.- (Art. 17a ELV). Zudem wird der aus dem verzichteten Vermögen erzielbare Ertrag als Einnahme angerechnet: Wenn wir von einer durchschnittlichen Verzinsung von 0.1 % ausgehen, wären CHF 249.90 (CHF 249‘882.- / 1‘000) anzurechnen. Der Betrag reduziert sich in den Folgejahren entsprechend. Bei gleichbleibender Verzinsung werden im nächsten Jahr folglich CHF 239.90 (CHF 239‘882.- / 1‘000) und im übernächsten Jahr CHF 229.90 (CHF 229‘882.- / 1‘000) usw. angerechnet.
10. Wie ist das Verhältnis von Ergänzungsleistungen zu Sozialhilfe sowie Verwandtenunterstützungspflicht?
Wird der Anspruch auf Ergänzungsleistung infolge eines Vermögens- bzw. Einkommensverzichts abgelehnt, bleibt nur der Gang zum Sozialamt. Bevor dieses allerdings Leistungen erbringt, wird die sog. Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB) im Verhältnis Kinder-Eltern-Grosseltern (Verwandte in auf- und absteigender Linie) geprüft.
Sofern es den Kindern finanziell und persönlich zumutbar ist, müssen diese ihre Eltern unterstützen. Die Zumutbarkeit ist dabei umso eher gegeben, als der Vermögensverzicht zu deren Gunsten ging. Insofern werden die durch den Vermögensverzicht Bedachten am Ende gegebenenfalls doch noch zur Kasse gebeten. Dieses Risiko (Bumerangeffekt) muss bei einem Vermögens- oder Einkommensverzicht immer beachtet werden.
Gemäss den Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) soll eine Unterstützungspflicht von Verwandten erst dann greifen, wenn das steuerbare Einkommen die folgenden Beträge übersteigt:
- Ehepaare, eingetragene Paare: CHF 180‘000.-
- Zuschlag pro Kind in Ausbildung: CHF 20‘000.-
- Alleinstehende: CHF 120‘000.-
Beim Vermögen wird Alleinstehenden ein Freibetrag von CHF 250‘000.- und Ehepaaren ein solcher von CHF 500‘000.- sowie pro Kind von CHF 40‘000.- belassen. Vom übersteigenden Teil wird ein Vermögensverzehr von zwischen 1/60 (bei unter 30-Jährigen) und 1/20 (bei über 61-Jährigen) beim Einkommen eingerechnet.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
1. Wie wird die Betreibung eingeleitet?
Die Betreibung ist ein Instrument des Gläubigers, um fällige Geldforderungen gegenüber säumigen Schuldnern geltend zu machen. Die Betreibung wird durch das Betreibungsbegehren eingeleitet. Dieses kann schriftlich oder mündlich an das Betreibungsamt am Wohnsitz des Schuldners gerichtet werden. Die im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen und Gesellschaften sind an ihrem Sitz zu betreiben (Art. 46 ff. SchKG). Folgende Angaben müssen im Betreibungsbegehren enthalten sein (Art. 67 SchKG):
- Name und Wohnort des Gläubigers (d.h., wenn Sie die Betreibung einleiten, Ihr Name und Wohnort) und dessen allfällige Bevollmächtigten, Bank-/Postverbindung bzw. IBAN-Nr. für eine allfällige Auszahlung des geschuldeten Forderungsbetrages;
- Name und Wohnort des Schuldners und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters;
- Forderungssumme in Schweizerwährung (und bei verzinslichen Forderungen der Zinsfuss und der Tag, seit welchem der Zins gefordert wird);
- Forderungsurkunde (z.B. Gerichtsurteil) und deren Datum bzw. der Grund der Forderung. Dem Begehren sind keine weiteren Dokumente (wie zum Beispiel Rechnungen, Mahnungen, Verträge) beizulegen, sofern der Grund der Forderung einfachheitshalber direkt auf dem Betreibungsbegehren angegeben wird. Handelt es sich bei der Forderung um monatlich / jährlich wiederkehrende Leistungen (wie aus Miete), ist der betreffende Zeitraum (Monat/e, Jahr/e) zwingend zu vermerken (z.B. Miete März – Mai 2018). Es empfiehlt sich für den Gläubiger das Begehren formfehlerfrei einzureichen. Ansonsten es aus rechtlichen, wie auch administrativen Gründen zu einer automatischen allenfalls kostenpflichtigen Rückweisung kommt.
Vorlagen für ein Betreibungsbegehren: https://gerichte.lu.ch/rechtsgebiete/schuldbetreibung_und_konkurs/betreibungsverfahren/betreibungsbegehren.
2. Wie viel kostet eine Betreibung?
Das Betreibungsamt erstellt aus einem Betreibungsbegehren einen Zahlungsbefehl und stellt diesen dem Schuldner zu. Die Gebühr ist vom Gläubiger vorzuschiessen und bemisst sich nach der Höhe der Forderung. Sie beträgt grundsätzlich:
|
Forderung CHF |
|
Gebühr CHF |
|
|
bis 100 |
20.30 |
|
über 100 |
bis 500 |
33.30 |
|
über 500 |
bis 1'000 |
53.30 |
|
über 1'000 |
bis 10'000 |
73.30 |
|
über10'000 |
bis 100'000 |
103.30 |
|
über 100'000 |
bis 1'000'000 |
203.30 |
|
über 1'000'000 |
|
413.30 |
Die Gebühr beinhaltet die Kosten für die Zustellung des Zahlungsbefehls (in der Regel CHF 8.00) und des Gläubigerdoppels (in der Regel CHF 5.30). Bei Problemen mit der Zustellung des Zahlungsbefehls können ausnahmsweise höhere Kosten entstehen (vgl. dazu GebVSchkG).
Die häufigsten Gebühren im Kanton Luzern sind, nebst den bereits erwähnten Kosten für den Zahlungsbefehl aufgelistet:
- Für die Entgegennahme einer Zahlung und deren Überweisung an den Gläubiger wird bis zu einem Betrag von CHF 1‘000.00 eine Gebühr von CHF 5.00 erhoben, ab einem Betrag über CHF 1‘000.00 beträgt die Gebühr 5 Promille des Betrags (jedoch höchstens CHF 500.00);
- Auch für den Vollzug einer Pfändung ist die Gebühr abhängig von der geltend gemachten Forderung. Bis zu einem Betrag von CHF 10‘000.00 beträgt die Gebühr zwischen CHF 10.00 und CHF 90.00;
- Für die Konkurseröffnung hat der Gläubiger einen Vorschuss von CHF 2‘000.00 zu leisten.
3. Wer trägt die Kosten einer Betreibung?
Grundsätzlich sind die Betreibungskosten vom Schuldner zu tragen, d.h. der Schuldner hat – zusätzlich zur gelten gemachten Forderung – die Kosten für die Betreibung zu erstatten. Die Kosten sind jedoch vom Gläubiger zu tragen, wenn die geltend gemachte Forderung gar nicht besteht und sich der Schuldner der Betreibung deshalb erfolgreich widersetzen konnte. Ausserdem sind die Kosten in jedem Fall vom Gläubiger vorzuschiessen. Deshalb hat der Gläubiger auch ein Kostenrisiko, da er den vorgeschossenen Betrag nur zurückerhält, wenn die Betreibung erfolgreich ist (d.h., wenn Vermögen oder Einkommen vorhanden ist).
4. Wie geht es weiter, wenn die Betreibung eingeleitet wurde?
Das Betreibungsamt überprüft das Betreibungsbegehren formell, aber nicht, ob die Forderung berechtigt ist. Nach Eingang des Betreibungsbegehrens erlässt das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl, welcher die Aufforderung enthält, entweder die Schuld innert 20 Tagen zu begleichen oder innerhalb von 10 Tagen Rechtsvorschlag zu erheben (Art. 69 SchKG).
5. Was ist ein Rechtsvorschlag und was bewirkt er?
Der Rechtsvorschlag ist eine schriftliche oder mündliche Erklärung des Schuldners (Art. 74 ff. SchKG). Dies kann bereits bei der Zustellung des Zahlungsbefehls oder bis 10 Tage danach getan werden, wobei die Formulierung «Rechtsvorschlag erhoben» mit Datum und Unterschrift ausreicht. Damit wird einerseits die geforderte Schuld bestritten und andererseits die Betreibung eingestellt.
6. Wie kann der Rechtsvorschlag beseitigt werden?
Falls der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben hat, muss der Gläubiger diesen zuerst beseitigen bzw. aufheben, um mit der Betreibung fortfahren zu können. Dies geschieht auf dem ordentlichen Prozessweg (Art. 79 SchKG) oder im Rechtsöffnungsverfahren (Art. 80 ff. SchKG), und zwar wie folgt:
- Im Zivilprozess oder Verwaltungsverfahren (Art. 79 SchKG): Wenn der Gläubiger keinen definitiven oder provisorischen Rechtsöffnungstitel (siehe nachfolgend) hat, muss er auf Anerkennung der Forderung klagen bzw. seinen Anspruch im Verwaltungsverfahren geltend machen. Mit der Anerkennungsklage macht der Gläubiger Bestand, Höhe und Fälligkeit der in Betreibung gesetzten Forderung im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls geltend und lässt den Rechtsvorschlag beseitigen. Die Klage ist entsprechend den zivilprozessualen bzw. verwaltungsrechtlichen Normen einzuleiten. Im Zivilverfahren ist der Prozess bei der Schlichtungsbehörde einzuleiten (Art. 197 i.V.m 202 ZPO). Die Anerkennungsklage muss die Anträge auf Verpflichtung des Schuldners zur Zahlung und auf die Beseitigung des Rechtsvorschlags in der genau bezeichneten Betreibung enthalten. Der Anerkennungsprozess wird abhängig vom Streitwert entweder im ordentlichen Verfahren (Streitwert > CHF 30‘000.00; Art. 219 ff. ZPO) oder im vereinfachten Verfahren (Streitwert ≤ CHF 30‘000.00; Art. 243 ff. ZPO) durchgeführt. Mit dem (positiven) Anerkennungsurteil wird der Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt. Sobald das Urteil i.S.v. Art. 336 Abs. 1 ZPO vollstreckbar ist, kann der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen (ohne nochmals das Rechtsöffnungsverfahren durchlaufen zu müssen).
- Definitive Rechtsöffnung (Art. 80 ff. SchKG): Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid (wie Gerichtsurteil, gerichtlicher Vergleich, gerichtliche Schuldanerkennung), so kann der Gläubiger beim Richter am Betreibungsort (Art. 84 i.V.m. 46 ff. SchKG) die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen. Wenn der Betriebene nicht durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt, gestundet oder bereits verjährt ist, wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, so dass der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen kann.
- Provisorische Rechtsöffnung (Art. 82 SchKG): Beruht die Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde (Art. 9 ZGB) festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung (wie z.B. zweiseitige Verträge [Miet- und Pachtvertrag, Darlehensvertrag, Arbeitsvertrag, Auftrag], Pfändungsverlustschein), so kann der Gläubiger beim Richter am Betreibungsort die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Der Richter spricht die provisorische Rechtsöffnung aus, sofern der Betriebene nicht sofort Einwendungen geltend macht, welche die Schuldanerkennung entkräften. Ist dem Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung erteilt worden, haben Schuldner und Gläubiger folgende Möglichkeiten:
- Der Schuldner kann innert 10 Tagen eine Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO ergreifen.
- Der Schuldner kann innert 20 Tagen Aberkennungsklage erheben (Art. 83 SchKG). Mit der Aberkennungsklage kann der Schuldner den Bestand der Forderung oder deren Fälligkeit im Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung bestreiten. Die Aberkennungsklage leitet ein ordentliches Verfahren beim Gericht ein. Ein Schlichtungsverfahren ist nicht notwendig (Art. 198 lit. e Ziff. 1 ZPO). Das negative Aberkennungsurteil stellt einen definitiven Rechtsöffnungstitel für die Durchsetzung der Forderung dar. Durch das abweisende Aberkennungsurteil wird die provisorische Rechtsöffnung zur definitiven.
- Der Gläubiger kann nach Ablauf der Zahlungsfrist die provisorische Pfändung oder bei einer Konkursbetreibung die Aufnahme des Güterverzeichnisse – je nach der Person des Schuldner (Art. 39 SchKG) – verlangen (Art. 83 SchKG).
7. Wie geht es weiter, wenn der Schuldner keinen Rechtsvorschlag erhoben hat bzw. der Rechtsvorschlag vom Gläubiger beseitigt werden konnte?
Wurde kein Rechtsvorschlag erhoben oder konnte der Rechtsvorschlag erfolgreich beseitigt werden, so kann der Gläubiger frühestens 20 Tage nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen, so dass die Betreibung fortgesetzt wird (Art. 88 SchKG). Dieses Recht erlischt ein Jahr nach der Zustellung des Zahlungsbefehls. Falls Rechtsvorschlag erhoben worden ist, so steht diese Frist zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten Gerichts- oder Verwaltungsverfahren still.
Sobald das Betreibungsamt das Fortsetzungsbegehren erhalten hat, so hat es entweder die Pfändung (z.B. Lohnpfändung; Art. 89 ff. SchKG) oder die Pfandverwertung (falls der Gläubiger ein Pfand für die Forderung besitzt; Art. 151 ff. SchKG; vgl. Verwertungsfristen gemäss Art. 154 SchKG) zu vollziehen oder den Konkurs anzudrohen, falls der Schuldner der Konkursbetreibung unterliegt (z.B. Inhaber einer im Handelsregister eingetragenen AG sind; Art. 39, 43, 159 ff. SchkG).
Pfändung bedeutet die behördliche Beschlagnahme von Vermögenswerten (Art. 96 SchKG). Das Betreibungsamt nimmt darüber ein Verzeichnis auf (Pfändungsurkunde; Art. 112 SchKG). Es werden nur so viel Vermögenswerte gepfändet, wie zur Deckung der Forderungen der Gläubiger nötig sind (Art. 97 Abs. 2 SchKG). Es kann auch Lohn des Schuldners gepfändet werden. Es darf jedoch nicht ins betreibungsrechtliche Existenzminimum des Schuldners eingegriffen werden (Art. 93 SchKG).
8. Was passiert, wenn der Schuldner kein pfändbares Vermögen hat?
Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein (Art. 149 Abs. 1 SchKG). Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne des Art. 82 SchKG (vgl. Ausführungen zu Frage 6) und gewährt dem Gläubiger die in Art. 271 Ziff. 5 (Arrest) und 285 SchKG (Anfechtungsklage) erwähnten Rechte. Der Gläubiger kann sodann während 6 Monaten nach Zustellung des Verlustscheins ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen.
9. Wann verjährt die vom Verlustschein betroffene Forderung?
Die durch den Verlustschein verurkundeten Forderung verjährt 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheins; gegenüber Erben des Schuldners jedoch verjährt sie spätestens 1 Jahr nach Eröffnung des Erbgangs (Art. 149a SchKG).
10. Ab wann gibt es einen Eintrag im Betreibungsregister und wie kann dieser Eintrag wieder gelöscht werden?
Der Betreibungsregisterauszug einer Person hat den Charakter eines amtlichen Protokolls. Es werden darin die Amtshandlungen des Betreibungsamtes gegenüber dieser Person vermerkt. Jede Betreibung wird im Betreibungsregister am Wohnort der Person eingetragen. Dies gilt auch für die bezahlten und die mit Rechtsvorschlag bestrittenen Betreibungen. Wenn ein Schuldner den Wohnsitz in eine andere Gemeinde verlegt, wird das neu zuständige Betreibungsamt für die betreffende Person ein neues Register anlegen, in welchem wiederum nur die dort erfolgten Betreibungen vermerkt sind. Es gibt kein «schweizerisches» Betreibungsregister. Um eine Gesamtübersicht über sämtliche Betreibungen zu erhalten, müssen die Betreibungsregisterauszüge aller früheren Wohnorte eingeholt werden.
Jede Person, die ein Interesse glaubhaft macht, hat ein Einsichtsrecht in den Betreibungsregisterauszug, so z.B. der neue Vermieter oder Arbeitgeber (Art. 8a SchKG).
Im Betreibungsregister erscheint:
- Eingeleitete Betreibungen (Zahlungsbefehle, Rechtsvorschläge) der letzten 5 Jahre;
- Unzustellbare, bezahlte und erloschene (abgelaufene) Betreibungen der letzten 5 Jahre;
- Pfändungsvollzüge und Konkursandrohungen der letzten 5 Jahre;
- Bezahlte Forderungen der letzten 5 Jahre;
- Nicht gelöschte Verlustscheine;
- Durchgeführte Privatkonkurse.
Der Betreibungsregisterauszug enthält keine Einträge (mehr), wenn:
- in den letzten 5 Jahren keine neuen (sofern keine Verlustscheine vermerkt sind) bzw. noch nie eine Betreibung eingeleitet wurde;
- oder alle Betreibungen von den jeweiligen Gläubigern zurückgezogen wurden;
- oder ein Gerichtsentscheid erwirkt worden ist, gemäss welchem die vom Gläubiger geltend gemachte Forderung nicht besteht oder die Betreibung schikanös war (und der Entscheid dem Betreibungsamt zugestellt wurde);
- oder wenn alle Verlustscheine getilgt und die quittierten Verlustscheine dem Betreibungsamt vorbeigebracht wurden.